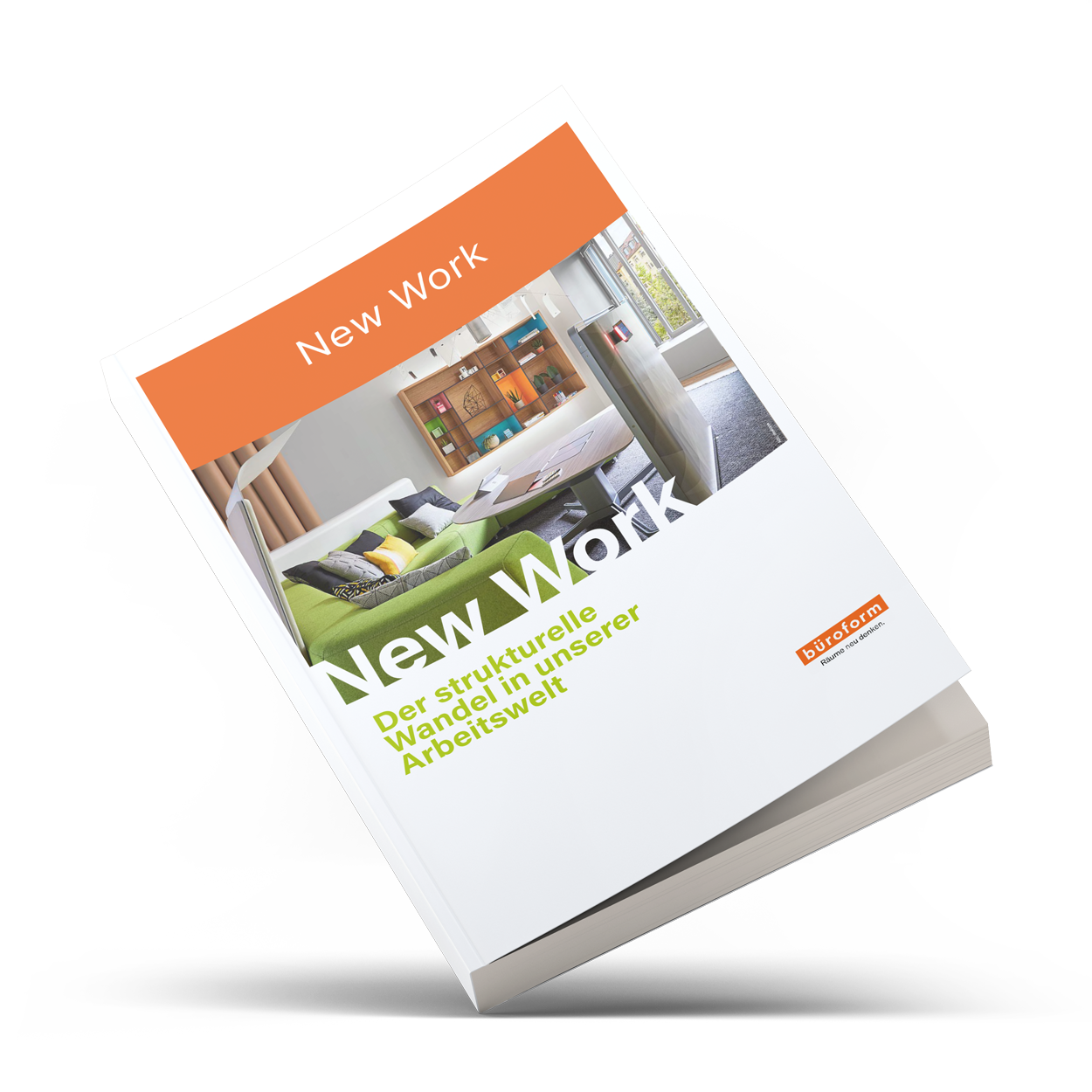Arbeitszeitmodelle

„9 to 5“ hat ausgedient!
Arbeitszeitmodelle haben sich gewandelt. Der „9 to 5“-Job hat ausgedient.
Die auf den Arbeitsmarkt drängende Generation Z fordert mehr als ein angemessenes Gehalt, sie möchten Arbeitszeitflexibilisierung, eine angemessene „Work-Life-Balance“. Und nicht nur sie! Spätestens durch die Pandemie und (positive) Erfahrungen aus dem Homeoffice wünschen sich auch Arbeitnehmer aus älteren Generationen mehr flexible Arbeitszeitmodelle. Auch die „Workforce Preference Study“ von PwC aus dem Jahr 2020 hat gezeigt, dass flexibel Arbeiten, sowie der Arbeit im Homeoffice eine große Bedeutung zugeschrieben wird – es ist vielen sogar wichtiger als das Gehalt! Fixe Arbeitszeiten und die 40-Stunden-Woche gelten als überholt und stehen modernen Arbeitsformen im Weg.
Moderne Arbeitszeitmodelle im Unternehmen einzuführen wird oft durch die Angst der Unternehmensführungen, Mitarbeiter würden weniger arbeiten, blockiert. Denn selbst wenn Mitarbeiter vielleicht ein bisschen weniger in flexiblen Strukturen arbeiten als in festen, so sind sie dafür wesentlich zufriedener, da Arbeits- und Privatleben durch Aspekte wie remote Work besser miteinander vereinbart werden können. Mitarbeiter sind ausgeglichener und gesünder, erledigen ihre Arbeit effektiver und bleiben so einem Unternehmen eher treu als in vorgeschriebenen Arbeitsmustern. Darüber hinaus erlaubt eine flexible Arbeitszeit es Unternehmensführungen auch auf die individuellen Mitarbeiterbedürfnisse zu reagieren. So können die besten Talente für den Betrieb gewinnen werden!

Flexible Arbeitszeiten brauchen flexible Räume!
Haben Unternehmensführungen erkannt, dass sie von modernen Arbeitszeitmodellen langfristig nur profitieren können, reicht es nicht lediglich das Arbeitszeitmodell umzustellen und alles andere beim Alten zu lassen. Denn so steif wie „9 to 5“ sind auch die Büroräumlichkeiten aus dieser Zeit – meist Zellenbüros, in denen jeder „sein eigenes Süppchen kocht“. Wer auf flexible Arbeitszeitmodelle umstellt, muss auch seine Büroräumlichkeiten dementsprechend anpassen, denn nur so können moderne Arbeitsmodelle auch gelebt werden. Es müssen sogenannte „hybride Multi-Spaces“ geschaffen werden. Dies sind flexibel gestaltete Arbeits- und Kommunikationsorte, die moderne digitale Technologien und Büroraumkonzepte miteinander vereinen und es den Nutzern ermöglichen, auf vielfältige Weise zu arbeiten und zu interagieren. Diese Räume umfassen beispielsweise Besprechungszonen, Arbeitsplätze, Lounge-Bereiche, Telefonkabinen und virtuelle Meetingräume. Durch die Integration von modernen Technologien wie Videokonferenzsystemen, interaktiven Displays und kollaborativen Tools bieten hybride Multi-Spaces eine maximal flexible Arbeitsumgebung, die sowohl persönliche Zusammenarbeit als auch virtuelle Interaktionen ermöglicht.

Existierende Büroräumlichkeiten in Eigenregie an flexibles Arbeiten anzupassen, sollte man lieber unterlassen. Zu riskant ist es, dass man als Laie wichtige Aspekte, wie die Verbindung des digitalen mit dem analogen Raum vernachlässigt oder gar ganz übersieht! Es empfiehlt sich daher Experten mit dem nötigen „Know-how“ zurate zu ziehen, die einen systematisch bei der gesamten Planung unterstützen können. Unser Team von büroform ist nicht nur durch seine diverse Zusammensetzung aus Innenarchitekten, Schreinern und Büroraumplanungsexperten der richtige Partner für ein solches Projekt, sondern auch weil wir mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Büroraumplanung mit uns bringen.
Gerne können Sie uns in einem ersten Kennenlerngespräch Ihre Bedürfnisse schildern. Gemeinsam erarbeiten wir, wie Ihre Büroräumlichkeiten am besten auf moderne Arbeitsformen umstrukturiert werden können. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Projekt!
Kontaktieren Sie uns
Für mehr Informationen kontaktieren Sie unser Team aus Innenarchitekten und Einrichtungsprofis.

FAQ
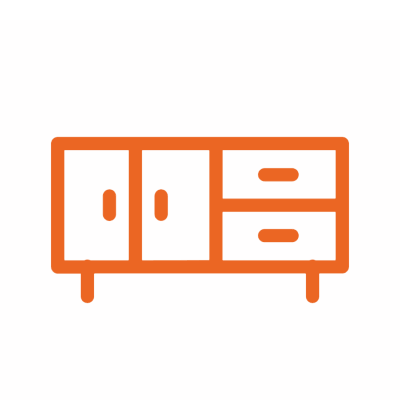

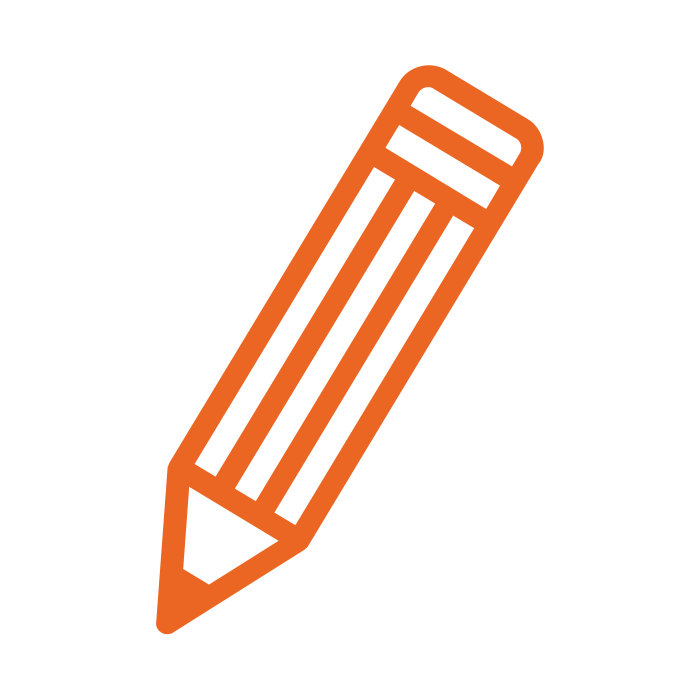

Bewertungen aus Büroplanung Stuttgart
Das sagen unsere Kunden
Einwandfreie Beratung und Umsetzung der neuen Büroeinrichtung. Vom Stuhl bis zur Raumakustik. Wir sind Herrn Ganz sehr dankbar für die wertvollen Tipps bei der Planung der neuen Büroräume. Er war immer gut erreichbar und reagierte schnell auf Änderungswünsche unserseits. Wir können Ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.
Peter Müller